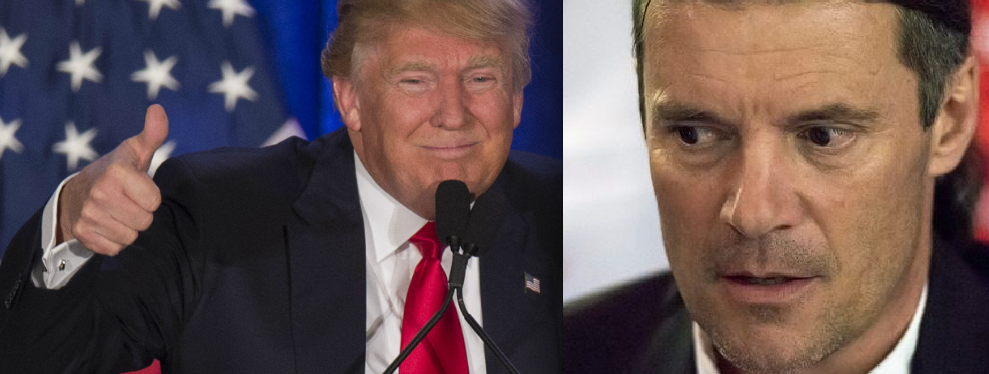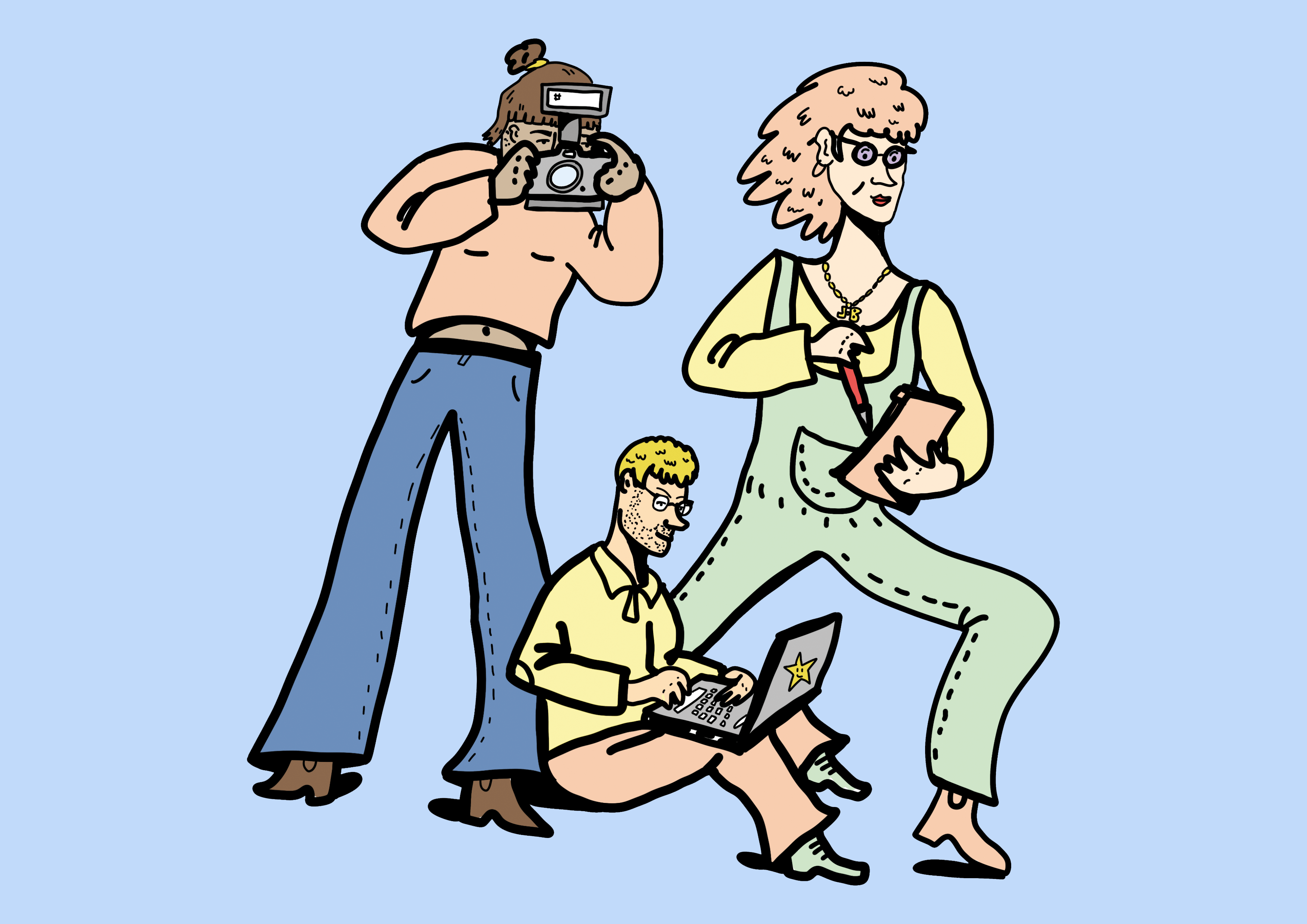Bekanntlich liegt der Teufel im Detail. Deshalb müsste Jean Ziegler in dem Tagi-Gespräch mit Res Strehle genauer werden, wenn er behauptet, positive soziale Impulse würden heute nur aus Süd-Amerika kommen. Für Normalsterbliche ist das in Anbetracht der dort vorherrschenden Zustände irgendwie nicht nachvollziehbar. Aber sonst ist der junge Mann von 80 Jahren in dem über Ostern erschienenen Interview schwindelerregend präsent und in seiner Direktheit schlicht bewundernswert!
Unbestritten ist dagegen, dass Kalifornien jener Teil der Welt ist, der uns absolut gnadenlos mit Impulsen bombardiert. Von dort soll, gemäss einer anderen Zeitung, demnächst auch ein elektrischer Lastwagen von Tesla auf uns zurollen, was unter Umständen ein Geschenk an die Menschheit werden könnte.
Warum allerdings ausgerechnet in Berkeley, wie die gleiche Zeitung meldet, kalifornische Wissenschaftler meinen herausfinden zu müssen, warum sich unsere Schuhbändel immer wieder lösen, ist eine andere Frage. Man kann das mit den Details nämlich auch übertreiben. Ich würde einfach auf den Rat meiner Mutter an uns Kinder zurückgreifen: Besser binden!
Ich schreibe dies übrigens in einem Hotel in Banja Luka in Bosnien und fühle mich deshalb berechtigt, zu behaupten, dass man auch auf Reisen eigentlich ins Detail geht. Zusammen mit meinem Freund und Kollegen Guy Krneta bin ich unterwegs in den Kosovo, wo wir für ein schweizerisch-kosovarisches Literaturprojekt ein bisschen vorsondieren wollen. Unter anderem haben wir gestern in Details mitbekommen, was man im sonstigen Europa ziemlich verlernt hat: Wie man im Auto über eine wirklich kontrollierte Grenzen kommt! Uniformierte Gestalten hinter kleinen Luken in eigenartigen, vermutlich schusssicheren Zöllnerhäuschen. Besonders in Regen und Schnee alles ein bisschen kompliziert, alles ein bisschen bedrohlich, eigentlich grotesk und kafkaesk. Und die DDR lässt grüssen.
Sogar diesen grünen Zettel mussten wir im Handschuhfach suchen. Dass es den überhaupt noch gibt, hatte ich schon fast vergessen.
Und was hat Alexander Egger damit zu tun?
Auch dieser versierte Berner Fotokünstler geht gerne ins Detail und produziert mit seinen neusten Bildern eine Schärfung des Hinschauens, die auch Blicke in neue, sogar sehr schöne Welten ermöglicht. Einzelne Motive verwandeln sich dabei sogar in etwas grundlegend Neues. Plötzlich wächst aus einer Erdnussschale ein kleiner Palmenwald wie hier im Bild.
To behold the world in a grain of salt! Um es mit William Blake zu sagen. Auch in einem Salzkorn ist die Welt zu sehen. Mehr davon gibt es vom 21. April bis zum 6. Mai in der galerie 9a am stauffacherplatz.