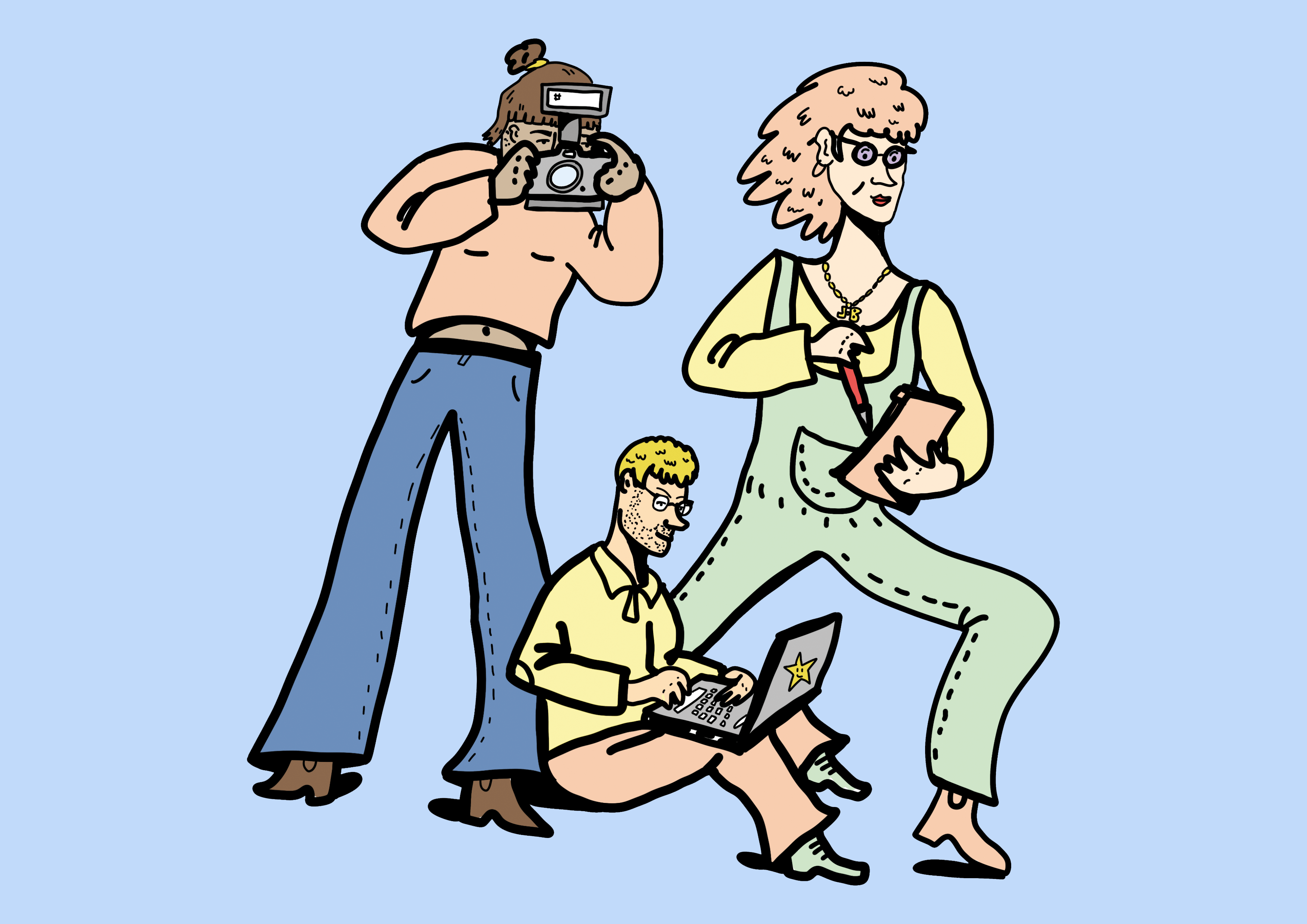Wieder und wieder landet der weisse Schmetterling auf der Himmelsblüte und im knallgelben Blütenkelch einer Kalebasse sucht eine Biene vergeblich den Ausgang. Auch was mir in den staunenden Mund geflogen ist und ich versehentlich herunterschluckte, war wohl eine Biene.
Nicht nur aus dem geliebten spanischen Garten, auch aus der schon fast grotesken Spanischen Politik müsste ich berichten, denn es sieht tatsächlich so aus, als ob es die ach so verantwortungsbewussten politischen Parteien schaffen werden, mit einem dritten Wahlgang dem doch ziemlich gebeutelten Land ein ganzes Jahr lang eine handlungsfähige Regierung zu verweigern. Nagt man da mal ein bisschen dran herum, wird einem fast schwindlig.
Aber dann las ich den Text von meinem lieben Kollegen Guy Krneta über das Buch «Der letzte Zeitungsleser».
Gut, ich reise nicht quer durch halb Spanien, um noch eine NZZ vom Tag zu ergattern, wie das Thomas Bernhard offensichtlich in Österreich getan hat. Aber mindestens zweimal die Woche fahre ich ins nahe Städtchen, um die Druckausgaben von El PAIS und von La VANGUARDIA zu kaufen. Dies sind zwei Zeitungen, die ich seit Jahren lese, die ich gut kenne, welchen ich auch dankbar bin für wertvolle Aufklärung und ungezählte Anregungen. Bei der LA VANGUARDIA gibt es sogar noch einen Bernbezug. Sie wird auf einer WIFAG-Maschine gedruckt.
Ärgerlich ist aber, dass auch diese beiden sogenannten Qualitätszeitungen zunehmend einfach allem, was schamlos nach Aufmerksamkeit schreit, auf den Leim gehen. Während wir unseren Kindern beibringen, nicht auf grossspurige Maulhelden hereinzufallen, sondern sie links liegen zu lassen und den eigenen Weg zu gehen, verleihen diese einst so stolzen Medien jedem Scharlatan beflissen eine Bühne.
Muss es sein, dass sie jetzt wieder so exzessiv über einen doch eher peinlichen ehemaligen Präsidenten Frankreichs berichten, ohne sich bewusst zu sein, dass sie nach seiner Pfeife tanzen? Ich will ganz sicher seinen Namen nicht noch einmal mehr in dieses System einspeisen, das sich hinter diesen elektronischen Zeilen hier verbirgt. Ebenso wenig wie ich den Namen jenes oberamerikanischen Oberamerikaners erwähnen will, mit dessen unappetitlicher Gegenwart diese Zeitungen meinen, mich monatelang foltern zu müssen.
Dieser Typ, bei dem man anführen könnte, er sei aus unergründlichen Gründen dort gelandet, wo er ist, wenn man es nicht besser wüsste! Er ist nur dort gelandet, weil er in jedem Medium ungerechtfertigt übervertreten ist, also jene Aufmerksamkeit bekommt, nach der er schreit wie ein Kind, die ihm aber gar nicht zusteht, weil er eigentlich von nichts eine Ahnung hat. The medium is the message! Das wussten schon unsere Grossmütter, aber nein – her das Bild! Zum tausendsten Mal! Her die Plattform! Wie platt! Wie platt!
Und was hat Alex Katz damit zu tun?
Ich habe diese Gedanken beim Lesen aufgeschrieben. Ich las das sonntags EL PAIS beigelegte Magazin und habe dabei auf unbedruckte, weisse Flächen gekritzelt. Und in diesem Magazin gibt es eine schöne Reportage über das Atelier von Alex Katz in New York. Er war mir als Künstler kein Begriff, bis ich vor ein paar Jahren mit meiner Familie durch Boston fuhr und an jedem Strassenlaternenpfahl ein Plakat von ihm mit einem Hinweis auf eine Ausstellung im Museum of Fine Arts hing.
Natürlich sind wir hingegangen.
War sehr schön!