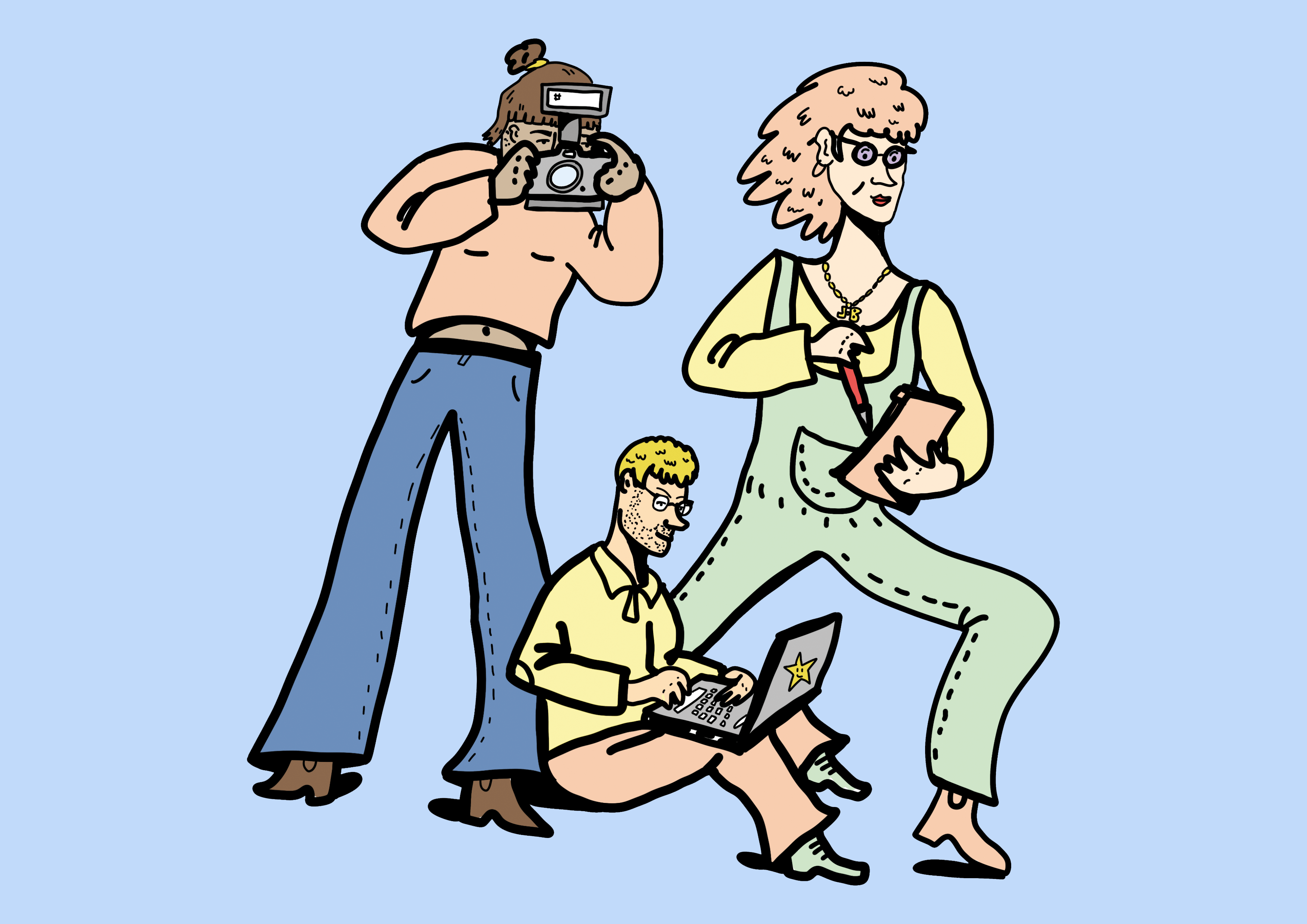Tanz ist Körperkunst. Das merken die Besucherinnen und Besucher im Stadttheater hautnah. Der Weg zum ersten Stück führt sie hinter den Vorhang, eng vorbei an Tänzerinnen und Tänzern in hauchzarten Kostümen, Bajaderen, die an lebende Skulpturen gemahnen. Auf der Bühne umrahmen harte Bänke die Tanzfläche. Man sucht die aushaltbare Sitzposition, schaut sich um und entdeckt etwa die Höhe des Bühnenturms, die Lichtwechsel von hell zu dunkel, das technische Ambiente, in dem man Platz genommen hat. Inmitten des weiten Runds der Bühne, unter einem riesigen goldenen Leuchter, beschäftigt ein Paar sich intensiv mit sich selbst.
Bald folgen die anderen Tänzer in das warme Halbdunkel, bilden einen lockeren Kreis um die beiden und beginnen eine kollektive Bewegung. Von unten dröhnen rhythmisch dumpfe Klänge, körperlich spürbar, eine Kanonade, das Stampfen eines Schiffsmotors? Die Bühne, eine spiegelnde Fläche, dreht sich langsam. Mit der Drehbewegung setzt ein anderer Sound ein: Just (after Song of Songs) von David Lang, elektronisch verstärkte Vokalmusik, die mit repetitiver Aufzählung von Körperteilen und Beziehungen eine meditative Atmosphäre schafft, die das Monotone der Tanzbewegungen verstärkt. Schliesslich bleibt das Paar wieder allein, gemeinsam, getrennt, scheiternd im Versuch sich neu zu finden. Leere.
Neubeginn nach der Pause
Die Pause bildet eine harte Zäsur. Sie vertreibt einen aus dem golden glänzenden und spiegelnden Paradies mit der Endlosmusik. Aus einem Ort ohne Zeit, an dem das Jahr nicht aus vier Zeiten besteht, sondern aus einer einzigen immer gleichen Saison. Was folgt?
Auf die ungewohnte Nähe der Besucher zu den Tänzerinnen und Tänzern folgt die gewohnte Distanz. Der Zuschauerraum der Guckkastenbühne vereinzelt. Jede und jeder blickt angestrengt nach vorne, um möglichst wenig zu verpassen. Die Musik, vor der Pause überall auch körperlich präsent, spielt nun im Orchestergraben, vom Parkett aus unsichtbar. Das Tanzen, das Musikmachen sind vom Zuschauen und Zuhören getrennt. Die Ordnung ist wiederhergestellt.
Und doch nicht. Denn jetzt geht es um die Vier Jahreszeiten, das Musikwerk aus dem Jahr 1725, das wir alle zu kennen glauben. Doch so sehr Vivaldi anklingt, es ist nicht Vivaldi. Es ist eine Neukomposition des deutschen Komponisten Max Richter, 2012 geschaffen als Four Seasons recomposed.
Zu diesem Werk, durch das der Konzertmeister Alexis Vincent zuerst auf der Bühne, dann im Graben das Berner Sinfonieorchester glänzend geleitet, führt das Tanzensemble eine Geschichte auf, die im Gang durch das Jahr von der Entwicklung der Menschen berichtet. Von der Erhebung zum aufrechten Gang, über das Leben im Kollektiv, die Liebe des Paars, die Solidarität und Gegnerschaft in der Gesellschaft, die Suche nach dem Höheren und die Kämpfe darum. Einmal im gleissenden Sonnenlicht, dann in kalt-grauer opaker Kälte und wiederum in den zarten Farben der Zwischenzeiten. Zuweilen ragt eine Tänzerin als Anführerin heraus. Und einmal erkundet sich eine im Spiegel, erprobt ihre Kraft an seinem Widerstand, scheitert als weiblicher Narziss.
Was könnte gemeint sein?
Ob es so gemeint ist? Ich lese es so oder ähnlich heraus. Ist es wichtig, die Geschichte zu verstehen, die erzählt wird? Nein. Worauf es ankommt ist, ob sie einen packt, fesselt und in Kopf und Herz zu eigenen Bildern anregt. Dies gelingt Estefania Miranda mit dem berührend, beflügelnd und diszipliniert tanzenden (und mit-choreographierenden) Ensemble und den stets neuen Bewegungen und Mustern individuell und im Kollektiv. Und dies gelingt dem BSO unter dem blutjungen Sebastian Schwab, mit einer fein differenzierten Musikalität, die aus dem Ohrwurmsound fast ein Kammerspiel werden lässt.
Nach dem zweiten Stück verlässt man das Stadttheater beglückt über das Erlebnis. Und rätselnd, was das erste Stück des Abends mit dem zweiten verbindet – und weshalb das gesamte Programm «Vier Jahreszeiten» heisst. Geht es – wie bei Kurt Tucholsky – im Grund um die «fünfte Jahreszeit», in welcher nach dem Sommer und vor dem Herbst die Natur ruht? Geht es um die Vertreibung aus dem Paradies und das wechselhafte Jahr hienieden? Ist es die Absicht, erlebbar zu machen, wie unterschiedlich man Tanz und Musik im Stadttheater wahrnimmt, je nachdem, wo man steht und sitzt? Ist das eine Parabel auf die Gesellschaft und unsere je unterschiedlichen Plätze darin?
Oder will uns Estefania Miranda einfach Fragen mitgeben? Wie es die Kunst tut, damit wir über uns selbst nachdenken.
Nachtrag
Der Zufall will es, dass vor kurzem am Opernhaus Zürich «Winterreise» Première hatte, ein Tanzstück von Christian Spuck nach der vom deutschen Komponisten Hans Zender 1993 «komponierten Interpretation» des berühmten Werks von Schubert. Das BSO führte das Werk im Herbst 2017 im Rahmen des Berner Musikfestivals in der Dampfzentrale auf. Nun also in Zürich. Zwei Neukompositionen, zwei darauf Bezug nehmende Tanzstücke, zwei ganz unterschiedliche Herangehensweisen: Eine Geschichte in Bern, zahlreiche Fragmente in Zürich. Den Besuch lohnen beide.