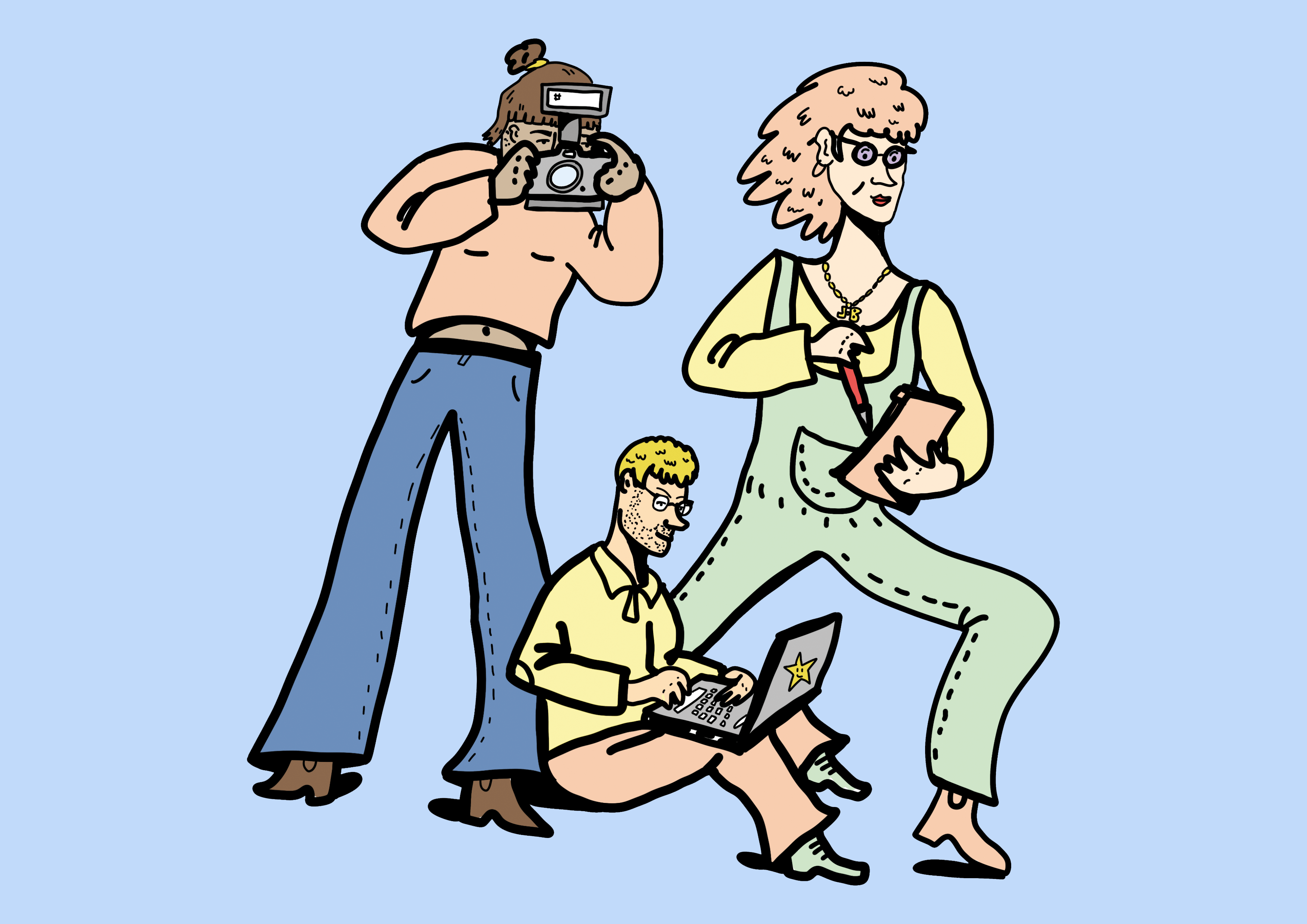BKA: Ralph Tharayil, der Weg zum Wasserfall wird im Titel gerade doppelt verneint. Worauf wollen sie damit hinaus?
Ralph Tharayil: Es geht nicht um Verwirrung, sondern um eine bewusste Umlenkung des bekannten Narrativs: des Jungen im Dschungel, der mit den Wölfen aufwächst und seine Erlösung findet. Diese Vorstellung eines Reinigungs- oder Erlösungsrituals existiert in meinem Text nicht. Ich versuche vielmehr, die Erzählung aufzufächern, bis vieles nicht mehr an seinem Platz steht.
Der Text, der nun im Januar von Regisseurin Miriam Ibrahim uraufgeführt wird, ist im Rahmen ihrer Hausautorenschaft entstanden. Warum gerade Mogli?
Mogli war aus europäischer Perspektive der erste nicht-weisse Disney-Charakter, in dem ich mich als indischstämmiger Mensch gesehen habe. Mogli war eine Schablone für mich: für die Selbstwahrnehmung und dafür, wie andere mich in einer weissen, europäischen Gesellschaft sehen. Mogli hat sich deshalb immer wieder in andere Projekte eingeschlichen, manchmal abstrakt, manchmal konkreter. Die Hausautorenschaft ermöglichte mir, den Stoff neu zu bearbeiten.
Wie treten Sie an Rudyard Kipling und sein Dschungelbuch heran?
Kipling hat Indien geliebt und gehasst. Er hat Indien glorifiziert, romantisiert und idealisiert, aber Inder verteufelt. Das konnte ich nicht nicht persönlich nehmen. Und dennoch gibt es bei Kipling etwas Existenzielles, das mich interessiert.
Ist die Erzählung von 1894 denn anschlussfähig für die Gegenwart?
Ich lese Mogli als zeitlose Figur. Was passiert, wenn ein Kind im Dschungel verloren geht? In welchen politischen Kontexten geschieht das? Und wird es wirklich zum Wolf? Für mich ist Mogli eine Leerstelle, auf die unterschiedliche Imaginationen zugreifen können – deshalb nimmt er im Stück auch verschiedene Formen an.
Ist das Dschungelbuch eine Geschichte der Anpassung?
Kipling war überzeugter Imperialist und Rassist. Sein Begriff vom «Gesetz des Dschungels» steht in dieser Tradition: Selbst das Wildeste, also der Dschungel, ist gesetzlich organisiert. Alles, was wild ist, kann gezähmt werden, und weil es gezähmt werden kann, kann auch ein Mensch sich ins Wilde integrieren. Es geht nicht um Anpassung, sondern um Unterwerfung und Integration – entweder du schaffst es oder du wirst ausgebeutet oder ausgeschlossen. Das lässt sich sehr gut auf heutige Gesellschaftsverhältnisse übertragen.
Ich lese Mogli als zeitlose Figur. Was passiert, wenn ein Kind im Dschungel verloren geht? In welchen politischen Kontexten geschieht das? Und wird es wirklich zum Wolf?
Wildheit spielt in diesem Stück eine zentrale Rolle. Warum?
Die Begriffe von Wildheit und Zivilisiertheit sind in den letzten Jahren wieder stark politisiert worden. Ich fand es spannend, mich mit Kiplings Text auseinanderzusetzen, der in einer sehr dezidierten Art versucht, die Grenze zwischen Menschen und Tier auszutarieren. Die vermeintliche Logik: Je klarer Trennlinien gezogen werden, desto klarer kann Zugehörigkeit definiert werden. Aber die Annahme ist falsch und führt zu Ausgrenzung und Gewalt gegen allerlei Menschen, die als vermeintlich «wild» oder «unzivilisiert» oder «anders» gebrandmarkt werden.
Im Stück tauchen neben Mogli, Balu, Bagheera etc. auch Figuren wie Tantalos, Mata Hari und eine Spinne auf. Weshalb diese Überlagerungen?
Das Interessante bei Überlagerungen ist, dass es zu neuen Konstellationen kommt, die Mogli in die politische Gegenwart holen. Mata Hari, die Kolonialgattin und Unterhalterin aus den Niederlanden, wird als Mutterfigur stilisiert. Tantalos aus der griechischen Mythologie, der ewige Qualen des Hungers und Dursts erleidet, ist das Sinnbild für Ressourcenknappheit und die Spinne ist die vermeintlich allmächtige Erzählfigur. Sie alle reaktualisieren Mogli, sie alle wollen auf Mogli zugreifen, um ihn erzählbar zu machen. Das ist mitunter überfordernd. Aber, den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr zu sehen, ist ein Gefühl, das ich aus der aktuellen Gegenwart kenne – der Text ist auch eine Versinnbildlichung davon.
«Mogli oder this way is not the way to the waterfall (wirklich nicht)» ist Ihr erstes Stück, das Sie explizit für die Bühne geschrieben haben. Wie haben Sie diesen Prozess erlebt?
Ich habe schon in früheren Arbeiten fürs Theater geschrieben, aber noch nie in so enger Zusammenarbeit mit einem Stadttheater. Die Frage, wie ich die Stimmen in meinem Kopf in Stimmungen übersetzen kann, hat mich lange umgetrieben. Die intensive Zusammenarbeit mit den Dramaturg*innen Felicitas Zürcher und Julien Enzanza war dafür zentral. Ich bin dankbar, dass daraus eine gemeinsame Sprache entstanden ist, und vielleicht ist es ja eine, mit der sich die Welt im Jahr 2026 erzählen lässt.
Vidmar 2, Liebefeld
Premiere: Mi., 21.1., 19.30 Uhr (ausverkauft). Aufführungen bis 5.5.

Dieses Interview ist zuerst in der Berner Kulturagenda erschienen.
 Ralph Tharayil ist in der Schweiz als Sohn südindischer Eltern geboren. (Foto: © Mirko Lux)
Ralph Tharayil ist in der Schweiz als Sohn südindischer Eltern geboren. (Foto: © Mirko Lux)