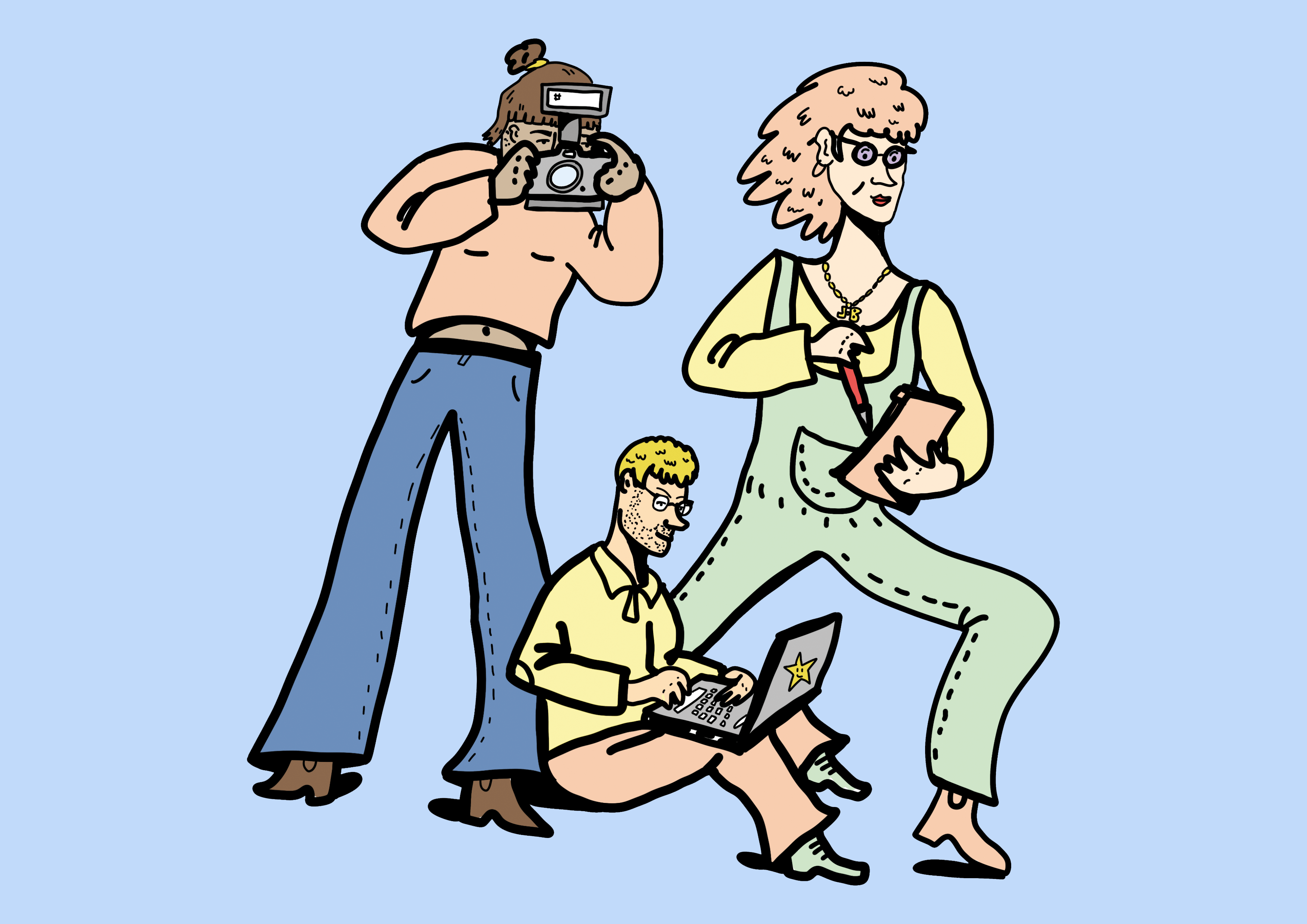Kurz bevor Salvatore Pittà Ende Juni von Zagreb nach Bern zurückreist, liest er eine E-Mail der in Deutschland arbeitenden «Welcome to Europe»-Koordinatorin und fühlt sich zuständig. Im Büro von «Solidarité sans frontières» erklärt er an diesem Beispiel, wie die Arbeit im Netzwerk konkret funktioniert.
Die Recherche auf der Nordseite
«Es ging um eine Mailanfrage, die die Leute des ‘Alarmphones’ (siehe unten) an ‘Welcome to Europe’ weitergeleitet hatten. Bereits am 26. Mai hatte ein syrischer Flüchtling in schwieriger Situation aus einem Boot, das von der Türkei nach Griechenland unterwegs war, einen Notruf an das Alarmphone abgesetzt. Die Rettungsaktion war danach erfolgreich.
Am 21. Juni meldete sich dieser gleiche Flüchtling wieder auf der Alarmphone-Nummer. Wegen Nichtzuständigkeit leitete man dort die Anfrage weiter an die Koordinatorin von ‘Welcome to Europe’. Diese schrieb ein Rundmail, schilderte das Problem und fragte an, ob jemand eine Idee zum Eingreifen habe.
Das Problem war folgendes: Der Syrer meldete, er sei unterdessen mit ungefähr zweihundert anderen Flüchtlingen an der Grenze zwischen Griechenland und Mazedonien. Das Wetter sei miserabel, sie seien entlang der Bahngeleise unterwegs gewesen – was übrigens immer wieder zu Todesfällen führt – und nun von der mazedonischen Polizei angehalten worden. Es gebe in der Gruppe Verletzte. Hilfe sei dringend nötig.
Meine Idee war nun, unser Netzwerk auf dem Balkan zu aktivieren. So nahm ich Kontakt mit den ‘Noborder’-Leuten in Belgrad auf, die ich eben besucht hatte, und fragte sie, ob sie mir via Preševo an der serbischen Südgrenze, wo sie ja mit ihrem Infomobil regelmässig unterwegs sind, einen vertrauenswürdigen Kontakt in Mazedonien verschaffen könnten. Tatsächlich schickten sie mir die Koordinaten einer Frau in der mazedonischen Hauptstadt Skopje, der ich über Facebook die Frage vorlegte, ob sie mir einen Kontakt zu Leuten verschaffen könne, die an der mazedonisch-griechischen Grenze aktiv seien. Die Frau wies mich auf eine offene Facebook-Gruppe hin mit dem Titel ‘Help the migrants in Macedonia’. Ich trat dieser Gruppe bei, schilderte die Situation und fragte, ob es Leute gebe, die an die griechische Grenze fahren könnten, um die absehbar eintreffenden zweihundert Flüchtlinge zu empfangen und zu unterstützen.
Die Recherche auf der Südseite
Gleichzeitig suchte ich nach Kontakten an der griechischen Nordgrenze. Weil das Netzwerk ‘Welcome to Europe’ 2009 auf der Insel Lesbos gegründet worden ist, ist es bis heute in keinem Land stärker verankert als in Griechenland. Dort liess man meine Anfrage zirkulieren und schliesslich kam der entscheidende Tipp, ich solle mich bei einem Mitglied einer Menschenrechtsgruppe in Thessaloniki melden.
Direkt vor meiner Abreise in Zagreb schilderte ich diesem Mitglied die Situation der Flüchtlingsgruppe in der Nähe von Eidomeni, einem griechischen Dorf an der Grenze zu Mazedonien. Er beschloss, umgehend dorthin zu fahren, und siehe da: Als ich mich nach der Ankunft in Bern wieder auf Facebook einloggte, erfuhr ich, dass er ein Team organisiert und grossartige Arbeit geleistet hatte: Man sei im Moment am Essen-Verteilen. Die Verletzten in der Gruppe habe man unterdessen in ein Spital überführt. Er selber unterstütze die Flüchtlinge dabei, ihren Protest gegen die Behandlung durch die mazedonische Polizei zu formulieren. Ob ich irgendwie mithelfen könne, die Geschichte in Westeuropa bekannt zu machen und so öffentlichen Druck zu erzeugen?
Jetzt war wieder ich in Bern dran. Ich aktivierte meine Kontakte, und schliesslich konnten wir Journalisten in Österreich, Deutschland, Italien, Griechenland und Mazedonien für die Sache interessieren. Es gab sogar welche, die an den Schauplatz reisten, um ihren Beitrag zu machen. Eine Woche später bot die mazedonische Polizei einen Deal an: Trotz einem Gesetz, das legale Einreisen von Flüchtlingen nach Mazedonien ausschliesst, dürfen die Flüchtlinge nun in Gruppen von bis zu zwanzig Personen einreisen.
Unterdessen war es auf der mazedonischen Seite der Facebook-Gruppe ‘Help the migrants in Macedonia’ gelungen, Leute zu organisieren, die nun ennet der Grenze bereit standen, die eintreffenden Zwanziger-Gruppen auf den Polizeiposten zu begleiten, wo man jeder Person ein Dokument für einen 72-stündigen legalen Aufenthalt in Mazedonien ausstellte. Danach wurden die Flüchtlinge unterstützt, rechtzeitig an die serbische Südgrenze zu kommen, um so ihren Weg Richtung Westeuropa auf der Balkan-Route fortsetzen zu können.
Politik mit humanitärer Nebenwirkung
Natürlich kann es nicht in jedem Fall so reibungslos klappen. Aber das Beispiel zeigt unsere Idee: Wie bei der Sklavenbefreiung auf der ‘Underground railroad’ helfen lokale Netzwerke von solidarischen Menschen den Flüchtlingsgruppen weiter. Und dank den elektronischen Kommunikationsmöglichkeiten konnte ich in diesem Fall eine Hilfsaktion mitinitiieren an einem Ort, den ich in meinem Leben noch nie gesehen habe.
Übrigens sieht es im Moment danach aus, als habe diese Aktion entlang der Balkan-Route neue Netzwerke aktiviert, von Griechenland im Süden bis Ungarn im Norden. Und à propos Ungarn: Dort gibt es zum Glück nicht nur den rassistischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán und seinen Stacheldraht. In der ungarischen Stadt Szeged an der serbischen Grenze zum Beispiel gibt es Aktivisten und Aktivistinnen, die mit uns via Budapest verbunden sind und den Flüchtlingen auch dort weiterhelfen.
Natürlich hat dieses Beispiel – wie unsere Arbeit insgesamt – einen humanitären Aspekt. Deshalb betone ich: Wir sind nicht humanitär. Unsere Analyse ist die, dass wir es mit einem systemischen Problem zu tun haben, das politisch bekämpft werden muss. Darum gehören neben der konkreten Hilfe und Unterstützung auch Medienarbeit, Demonstrationen und weitere Arten der Sensibilisierung der Bevölkerung dazu.
Es soll nicht nur ein Brötchen gegeben werden, obschon das auch getan werden muss. Wir wollen darüber hinaus das Brötchen sichtbar machen als Symptom eines Problems, das erst dann gelöst sein wird, wenn jene, die heute unser Brötchen zum Überleben benötigen, wieder selber Brot backen können.»